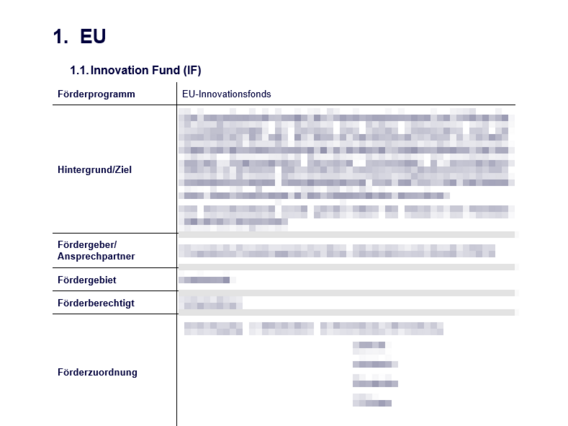Brennstoffzellen: Wasserstoff wird in Brennstoffzellen verwendet, um Elektrizität zu erzeugen. Dies ist besonders relevant für die Mobilität, die emissionsfrei betrieben werden soll. Aber auch stationäre Brennstoffzellen für die Energieerzeugung sind ein Anwendungsfall. Stichwort Sicherheit: Es gibt häufig Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, da Wasserstoff ein hochentzündliches und flüchtiges Gas ist. Hier sind einige Punkte, die die Sicherheit von Wasserstoffsystemen unterstreichen:
- Moderne Sicherheitsstandards: Wasserstofffahrzeuge und Brennstoffzellen sind nach strengen Sicherheitsstandards entwickelt und getestet. Diese Standards stellen sicher, dass die Systeme auch unter extremen Bedingungen sicher funktionieren.
- Robuste Tanks: Wasserstoff wird in speziell entwickelten Drucktanks gespeichert, die extrem widerstandsfähig sind und hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Diese Tanks sind so konstruiert, dass sie im Falle eines Unfalls intakt bleiben.
- Leck-Detektion: Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb sind mit fortschrittlichen Leckage-Detektionssystemen ausgestattet, die sofort auf Wasserstoffaustritt reagieren und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einleiten.
- Schnelle Diffusion: Wasserstoff ist sehr leicht und diffundiert schnell in die Atmosphäre, was die Gefahr einer Ansammlung und damit die Explosionsgefahr reduziert.
- Erprobte Technologie: Wasserstoff und Brennstoffzellen werden seit Jahrzehnten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von der Raumfahrt bis zur Industrie, und haben sich als sicher und zuverlässig erwiesen.
Direktreduktion im Stahlsektor: Wasserstoff kann als Reduktionsmittel in der Stahlproduktion eingesetzt werden, um den Einsatz von Kohle zu ersetzen und die CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren.
Chemische Industrie: Wasserstoff ist ein wichtiger Rohstoff in der chemischen Industrie, wo er zur Herstellung von Ammoniak, Methanol und anderen Chemikalien verwendet wird.
Energieerzeugung: Wasserstoff kann z.B. in angepassten Gasturbinen oder Gemischen mit Erdgas verbrannt werden. Das macht ihn zu einer flexiblen und emissionsarmen Energiequelle. Aber: Effizienzverluste sind hierbei hoch (Strom wird umgewandelt in → H₂ wird verbrannt und dabei (wieder) in → Strom umgewandelt). Ganz Emissionsfrei ist Wasserstoff als Brennstoff auch nicht. So können je nach Verfahren unterschiedlich starke NOₓ-Emissionen entstehen. Deshalb ist Wasserstoff eher als Backup-Lösung oder in speziellen Anwendungsfällen sinnvoll, nicht als Dauerlösung der Energieerzeugung.
Speicherung von erneuerbarer Energie: Wasserstoff kann als Speichermedium für überschüssige erneuerbare Energie genutzt werden, indem er durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen wird. Diese Energie kann später wieder in Strom umgewandelt werden, wenn die Stromnachfrage nicht durch erneuerbare Quellen wie Wind und PV gedeckt werden kann.
Erzeugung von Prozesswärme: In der Industrie kann Wasserstoff anteilig den Brennern beigemischt werden. Dadurch kann Wasserstoff in energieintensiven Branchen eingesetzt werden, bis es zu einer kompletten Umstellung auf Wasserstoff kommt.